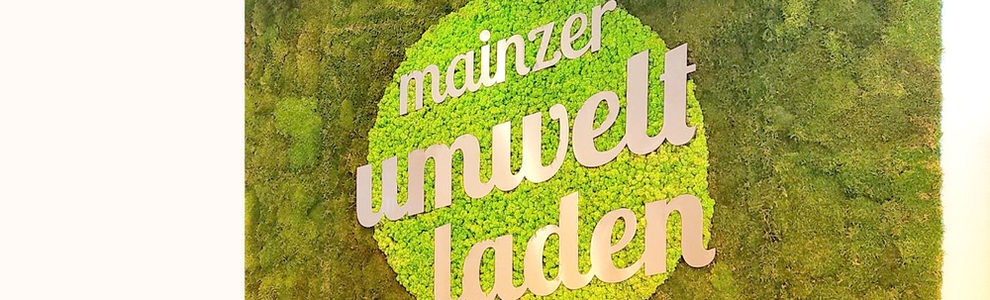Umwelttipp Reisetrend Camping: Es geht auch nachhaltig
Sobald der Frühling lockt und die Tage länger werden, steigt die Reiselust. Camping ist eine Urlaubsbewegung mit Erfolgsgeschichte - fast schon eine Philosophie.
Vom Zeltpionier zum Vanlife
Camping entstand Anfang des 20. Jahrhunderts, als nach dem 1. Weltkrieg der Aufschwung mit den Goldenen Zwanzigern Einzug in Deutschland hielt. Erstmals konnten sich Normalverbraucher:innen Urlaub leisten, zuvor hatten Arbeitnehmer:innen keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Es lag nahe, in der freien Natur kostengünstig zu regenerieren. Die Pioniere campten anfangs als „Wochenendbewegung“ mit einfachen Zelten und Gegenständen zur Erholung, wie z.B. Faltbooten.
Durch den 2. Weltkrieg wurden die Aktivitäten unterbrochen. Erst nach Kriegsende und mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder konnte sich die breite Masse wieder Urlaub leisten. Der im Jahr 1931 erfundene Wohnwagen - heute Caravan - trat seinen Siegeszug an. Es entstanden Begriffe wie „Stoffvilla“ oder „Haus am Haken“. In den 1960er Jahren startete eine auf Camping spezialisierte Industrie. Schließlich wurden extra Fahrzeuge, wie der kultige VW-Bus, für das Camping umgebaut und auf dieser Basis stetig weiterentwickelt.
Neuere Trends umfassen „Glamping“, eine luxuriöse Form des Campings oder „Vanlife“, das Wohnen und Reisen in einem Freizeitfahrzeug - vorzugsweise in einem Wohnmobil.
Was Camper bewegt
Die Beweggründe, sich für Campingurlaub zu entscheiden, sind vielfältig. Für viele ist es die Sehnsucht nach Natur in Verbindung mit individuellen Urlaubswünschen, deren Ausleben ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Gerade Familien profitieren davon, beim Camping mit Kindern und Freunden ungezwungen einen hohen Freizeitwert zu genießen. Allerdings hat sich inzwischen aus dieser preiswerten, einfachen, naturnahen Urlaubsform eine materialgetriebene Campingindustrie und -infrastruktur entwickelt, die den von zu Hause gewöhnten Komfort nicht missen lässt.
Mit rund 42,3 Millionen Gästeübernachtungen haben im Jahr 2023 so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet (Quelle: Statistischem Bundesamt). Mit einem Branchenumsatz von rund 15,1 Milliarden Euro in 2024 erzielt die deutsche Caravaning-Industrie das zweitbeste Umsatzergebnis ihrer Geschichte nach 2023 (Caravaning Industrieverband e.V.). Fast 100.000 Neuzulassungen an Caravans und Freizeitmobilen gibt der Verband für 2024 an.
Dieser Reiz des Campings hat seinen Preis. Wohnmobile sind inzwischen so teuer wie Eigentumswohnungen. Aber auch die Auswirkungen des Campingbooms auf die Umwelt werden zunehmend kritisch gesehen.
Negative Auswirkungen des Campingbooms
Nachfolgende Kritikpunkte in Bezug auf den Camping-Trend werden häufig genannt:
CO₂-Ausstoß: Nicht nur Flugreisen verursachen eine schlechte CO₂-Urlaubsbilanz. Es liegt auf der Hand, dass Wohnmobile, die zum „Herumstromern“ konstruiert wurden, sich ebenfalls negativ auf die CO₂-Bilanz auswirken. Im Vergleich zur Flugreise soll der verringerte CO₂-Ausstoß - je nach Wohnmobil-Typ - gegenüber einer Flugreise nur etwa 10 Prozent betragen. Der Kraftstoffverbrauch ist höher als beim Pkw. Durch Größe, Aufbauten und hohes Gewicht kann dieser zwischen 10 - 30 Litern pro 100 km liegen. E-Fahrzeuge haben sich hier noch nicht durchgesetzt, da wiederum große Batterien mit zusätzlichem Gewicht benötigt würden.
Material- und Ressourcenverbrauch: Ein drei Tonnen schweres Wohnmobil wiegt mindestens das Doppelte eines Pkws und verbraucht damit auch mehr Material und Ressourcen. Hinzu kommen dann noch Ein- und Aufbauten wie Küche, Schlafgelegenheiten und anderer Wohnkomfort wie Kühlschrank, TV, Standheizung uvm. Ein solches Fahrzeug ist in der Regel nicht alltagstauglich und wird zusätzlich zum Pkw angeschafft.
Kauf und Nutzung: Kostspielige Campingmobile werden neu gekauft, doch die meiste Zeit des Jahres stehen sie ungenutzt auf dem Parkplatz herum. In den Städten mit knapp vorhandenem Platz versperren sie den öffentlichen Raum.
Natur und Müll: Autark ausgerüstete Fahrzeuge machen es möglich: Es kommt vor, dass Naturliebhaber:innen mit ihrem Camper in die Natur eindringen, statt auf befestigten Wegen und auf ausgewiesenen Plätzen zu bleiben. Vielerorts fehlen Sanitäranlagen, Wasseranschlüsse und Möglichkeiten zur Müllentsorgung. Überforderte Kommunen ohne entsprechende Infrastruktur beklagen eine Zunahme des Wildcampens mit unsachgerecht entleerten Chemietoiletten und zurückgelassenen Müllbergen. So kann der Wunsch nach Naturnähe der Natur schaden.
Tipps, wie Sie Ihren Campingurlaub umweltfreundlicher machen
Auswahl eines Camping-Fahrzeugs: Der Markt im Reisemobilsektor ist groß. Im Van findet sich selbst auf kleinstem Raum mittlerweile alles, was man für unterwegs braucht. Sie sparen dadurch Anschaffungs- und Unterhaltskosten. Ein kleineres Fahrzeug ist leichter und verbraucht weniger Material. Der CO2-Ausstoß und der Reifenabrieb sind geringer. Ein Campingbus kann auch im Alltag genutzt werden. Grundsätzlich gilt, je länger man das Reisefahrzeug nutzt, desto besser fällt seine Ökobilanz aus. Auch ein Wohnwagen kann eine Alternative sein.
Selbstausbau: Wenn Sie Ihr Basisfahrzeug selbst ausbauen möchten, können Sie auf nachhaltiges Baumaterial zurückgreifen. Auch das Upcycling ausgedienter Möbel ist eine Option, wenn diese nicht zu schwer sind. Ein relativ neuer Trend auf dem Camping-Markt sind mobile Camping-Boxen. Bett, Küche oder Sanitäranlagen können oft von nur einer Person ohne handwerkliche Kenntnisse in das Fahrzeug eingesetzt und nach dem Urlaub einfach wieder herausgenommen werden. Literaturtipps für den Selbstausbau befinden sich im Anhang.
Energiegewinnung: Teurer Campingplatzstrom für Kühlen, Heizen und Licht muss nicht sein. Für Camper gibt es passende Solarmodule und Zubehör, die auch bei Verkauf eines Fahrzeugs weiterverwendet werden können.
Toilette und Wasserhygiene: Eine Komposttoilette oder eine Trockentrenntoilette sind Alternativen zur Chemietoilette. Auch zur Desinfektion von Wassertanks gibt es umweltfreundliche Produkte, z.B. mit Hilfe von UV-Licht.
Umweltbilanz: Mieten statt kaufen verbessert Ihre Umweltbilanz. Campingfahrzeuge werden mittlerweile bundesweit bei professionellen Anbietern und auf dem Privatmarkt vermietet. Eine Alternative kann auch sein, das Wohnmobil im Zielland anzumieten und umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.
Übernachten: Achten Sie bei der Planung Ihrer Übernachtungsziele auf Campingplätze mit besonderem Nachhaltigkeitsmanagement. Infos dazu finden Sie in der Linkliste im Anhang.
Für Minimalisten: Auch das klassische Camping mit Zelt im Rucksack zu Fuß oder unterwegs mit dem Fahrrad bereitet traumhafte, unvergessliche Urlaube. Statt Luxus und Bequemlichkeit stehen die Erlebnisse im Vordergrund. Selbst die Campingausrüstung lässt sich leihen oder teilen.
Weitere Informationen
Adresse
- Telefon
- +49 6131 12-2121
- Telefax
- +49 6131 12-2124
- umweltinformationstadt.mainzde
- Internet
- Veranstaltungen im Umweltladen
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten:
Montag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Mittwoch: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Freitag: 10 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr
Jeder 1. Samstag im Monat: 10 Uhr bis 14 Uhr
Erreichbarkeit
Haltestellen / ÖPNV
Linien: 6, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 78,
80, 81, 90, 91, 653, 654, 660